Keine Bindung an das Strafurteil: MPU und Fahrerlaubnisentziehung trotz Fahrverbot
Die Entscheidung des VGH München (Beschluss vom 24.09.2025 – 11 CS 25.1412) zeigt sehr eindrücklich, wie deutlich Strafverfahren und Fahrerlaubnisverfahren auseinanderfallen können. Für viele Betroffene wirkt es zunächst widersprüchlich: Das Strafgericht verhängt nur ein einmonatiges Fahrverbot, später ordnet die Fahrerlaubnisbehörde jedoch eine MPU an – und wenn diese nicht fristgerecht beigebracht wird, wird die Fahrerlaubnis vollständig entzogen. Der Eindruck, die Sache sei doch „schon vor Gericht erledigt“, ist weit verbreitet. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, wenn das Strafurteil keine ausdrückliche Prüfung und Bewertung der Fahreignung enthält.
Ausgangspunkt war eine Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,86 ‰ in nächtlicher Situation und auf kurzer Strecke. Das Strafgericht verzichtete auf die Entziehung der Fahrerlaubnis und beschränkte sich auf ein Fahrverbot und eine Geldstrafe. In den schriftlichen Urteilsgründen fand sich lediglich der knappe Hinweis, eine Entziehung der Fahrerlaubnis sei „nicht angezeigt“. Diese Formulierung klingt für viele Laien wie eine Entscheidung zugunsten der Fahreignung – tatsächlich sagt sie über eine solche Prüfung jedoch nichts aus.
Warum das Strafurteil die Behörde nicht bindet
Das Fahrerlaubnisrecht verlangt für eine Bindung an das Strafurteil eine erkennbare und inhaltlich nachvollziehbare Fahreignungsprüfung durch das Strafgericht. Das heißt, das Strafgericht müsste ausführen, warum es trotz der Alkoholfahrt davon ausgeht, dass die betroffene Person künftig in der Lage ist, Alkoholkonsum und Teilnahme am Straßenverkehr zuverlässig voneinander zu trennen. Erst wenn diese Überlegung im Urteil nachvollziehbar dokumentiert ist, hat sie Bindungswirkung.
Genau das aber fehlte. Die Aussage, eine Entziehung der Fahrerlaubnis sei „nicht angezeigt“, bleibt rein strafzumessungsbezogen und eröffnet keinerlei Einblick in eine eigenständige Eignungsbeurteilung. Der VGH weist ausdrücklich darauf hin, dass Strafgerichte in solchen Fällen häufig – bewusst oder unbewusst – gerade keineEignungsprüfung durchführen. Das hat Gründe: Strafgerichte urteilen nach dem Schuldprinzip und unterliegen dem Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“. Die Prüfung der Fahreignung findet dort oft nur am Rande statt. Eine medizinisch-psychologische Begutachtung kann das Strafgericht ohnehin nicht anordnen. In der Praxis führt dies dazu, dass die strafrechtliche Entscheidung regelmäßig keine abschließende Aussage über die Eignung enthält.
Genau hier setzt das Fahrerlaubnisrecht an. Die Fahrerlaubnisbehörde hat die Pflicht, die Verkehrssicherheit umfassend zu schützen. Bei einer Alkoholfahrt ab 1,6 ‰ – unabhängig davon, ob mit PKW, Fahrrad oder E-Scooter – muss deshalb eine MPU angeordnet werden. Wird dabei kein Gutachten vorgelegt, darf die Behörde nach § 11 Abs. 8 FeV folgern, dass eine fehlende Fahreignung vorliegt. Diese Rechtsfolge ist zwingend und lässt keinen Ermessensspielraum zu. Es genügt also nicht, sich auf das frühere Strafurteil zu berufen – die Nichtvorlage der MPU führt als eigenständiger rechtlicher Grund zur Entziehung der Fahrerlaubnis.
Was diese Entscheidung für die Praxis bedeutet
Die Entscheidung macht erneut deutlich, dass die größte Gefahr nach einer Alkoholfahrt nicht im Strafverfahren liegt, sondern im Fahrerlaubnisrecht. Selbst ein vergleichsweise mildes strafrechtliches Urteil kann keinerlei Schutzwirkung entfalten, wenn es keine tragfähige, schriftlich erkennbare Feststellung der Fahreignung enthält – und das ist in der überwiegenden Zahl aller Verfahren der Fall.
Wer glaubt, „ein Monat Fahrverbot und dann ist es vorbei“, riskiert wenige Wochen später ein Schreiben der Fahrerlaubnisbehörde mit der Aufforderung, eine MPU beizubringen. Erfolgt dann keine strategische, gut vorbereitete Reaktion, steht am Ende regelmäßig der Verlust der Fahrerlaubnis auf unbestimmte Zeit.
Deshalb sollte die Frage der Fahreignung bereits während oder sogar vor dem Strafverfahren mitbedacht werden. Die Abstimmung zwischen Strafverteidigung und Fahrerlaubnisrecht entscheidet in solchen Fällen oft über den gesamten weiteren Verlauf: Wird rechtzeitig gegengesteuert, kann die MPU vorbereitet, strukturiert angelegt oder in manchen Konstellationen sogar vermieden werden. Wird erst reagiert, wenn die Begutachtung bereits angeordnet ist, ist der Spielraum in der Regel sehr viel kleiner.
Wir beraten und begleiten Mandantinnen und Mandanten sowohl im strafrechtlichen Verfahren wegen Trunkenheitsfahrten als auch im anschließenden Fahrerlaubnisverfahren, insbesondere bei MPU-Anordnungen und Fragen der Abstinenz- oder Trennungsfähigkeit. Eine frühzeitige strategische Ausrichtung erspart häufig erhebliche Folgekosten und verhindert den Verlust der Fahrerlaubnis.
Ihr Ansprechpartner für Verkehrsrecht in Berlin – Rechtsanwalt Thomas Brunow

Rechtsanwalt Thomas Brunow ist Ihr erfahrener Rechtsanwalt für Verkehrsrecht in Berlin Mitte. Als Spezialist auf diesem Gebiet vertritt er Mandanten ausschließlich in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten – von der Schadenregulierung über Bußgeldverfahren bis hin zur Verteidigung in Verkehrsstrafsachen.
Dank seiner langjährigen Erfahrung und seiner Tätigkeit als Vertrauensanwalt des Volkswagen- und Audi-Händlerverbandesgenießt er großes Vertrauen in der Automobilbranche. Zudem ist er aktives Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht.
Leistungen von Rechtsanwalt Thomas Brunow:
✔ Schadenregulierung nach Verkehrsunfällen – Durchsetzung von Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüchen.
✔ Verteidigung in Verkehrsstrafsachen – Spezialisierung auf Trunkenheitsfahrten, Fahrerflucht, Nötigung und Körperverletzung im Straßenverkehr.
✔ Verteidigung in Bußgeldverfahren – Umfassende Expertise bei Geschwindigkeitsverstößen, Rotlichtvergehen und Fahrtenbuchauflage n.
Mit Fachwissen, Erfahrung und Durchsetzungsstärke sorgt Rechtsanwalt Thomas Brunow für eine effektive Vertretung im Verkehrsrecht.
📍 Kanzlei Prof. Dr. Streich & Partner
📍 Eichendorffstraße 14, 10115 Berlin
📞 Telefon: 030 226357113

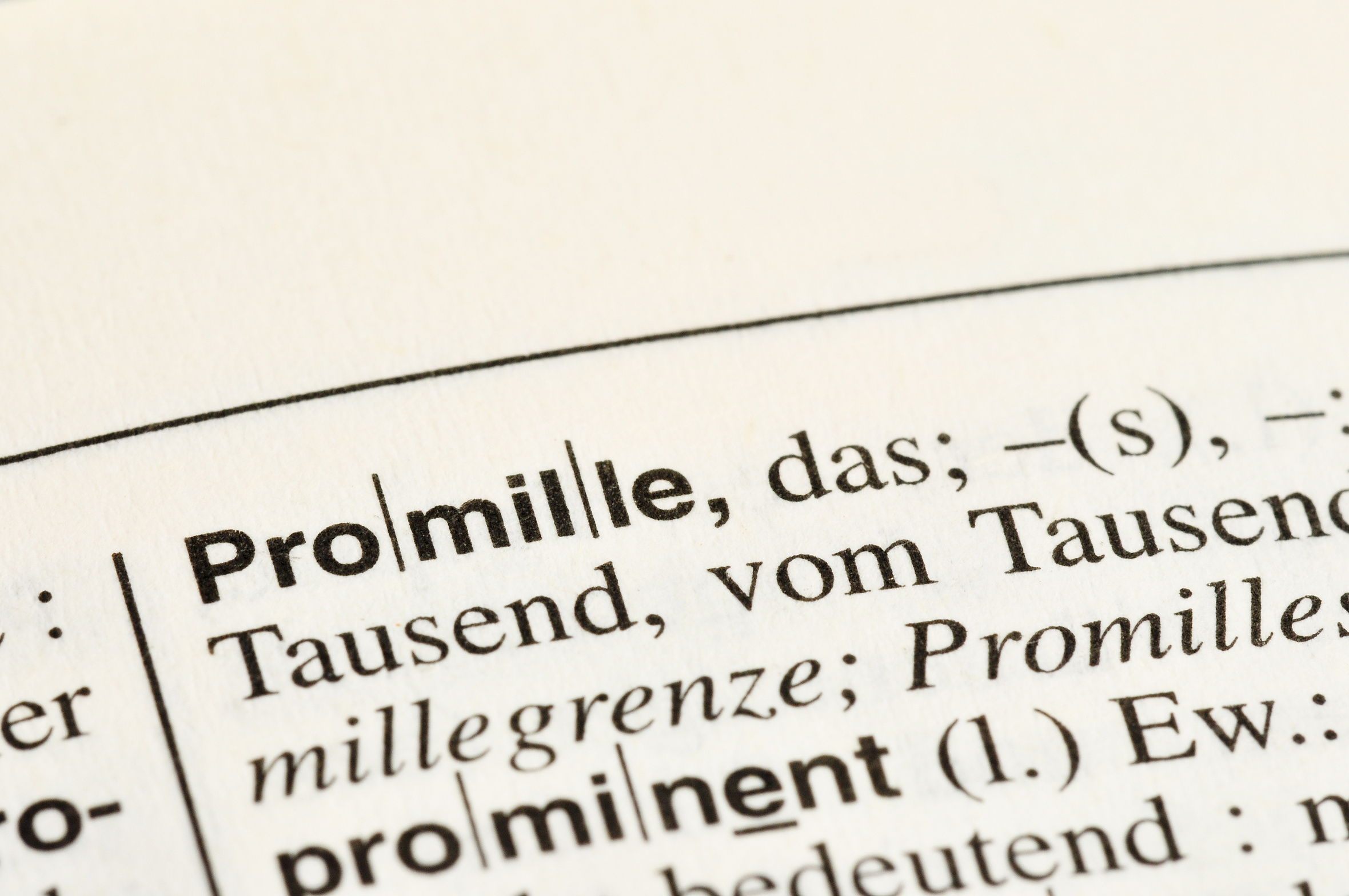
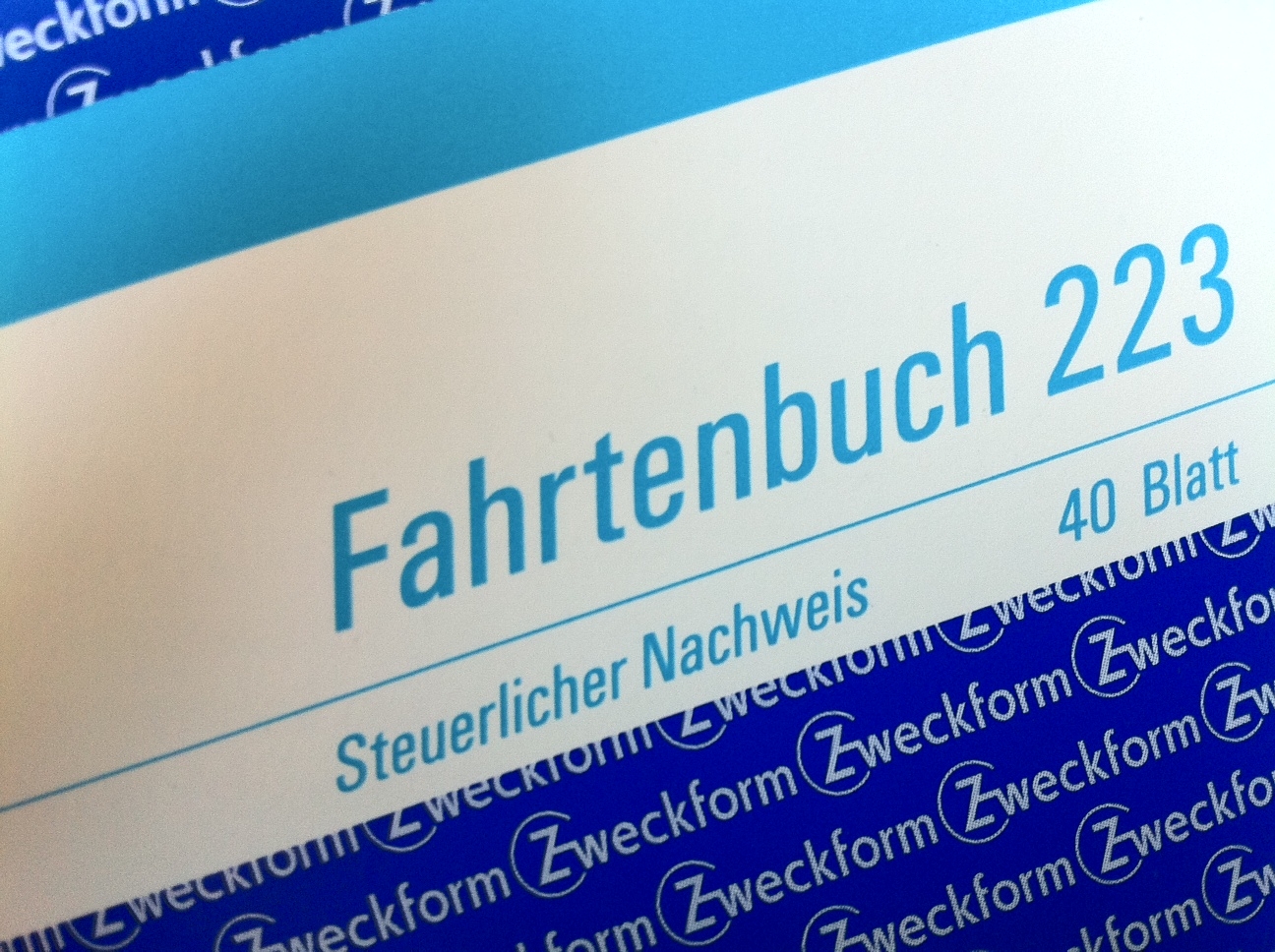







Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.